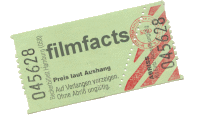
|
Eine Frau, die scheinbar völlig verwirrt und orientierungslos über eine menschenleere Straße hastet, eine entsetzliche Rückenverletzung, die die Kamera nur schemenhaft im diffusen Dämmerlicht des Straßenzuges einfängt und ein fast menschenleerer Omnibus, der wie ein fliegender Holländer scheinbar aus dem Nichts heranbraust und dem bereits gequälten Leben ein jähes Ende bereitet - schon in seiner makaberen Anfangssequenz gibt der Film seine Marschrichtung ins dunkle Herz der Finsternis vor. Die Kamera erspart den direkten Anblick des Aufpralls, sondern schwenkt anschließend ganz langsam zur Seite auf ein kaum weniger erschreckendes Szenario: Den havarierten, zerschmetterten Bus, der offensichtlich in einem letzten verzweifelten Versuch seines Lenkers zum Ausweichen selbst in sein Verderben gesteuert ist. Und wieder ist nirgends ein lebender Mensch zu sehen.
Es ist die pure Trostlosigkeit, die Verlorenheit des Individuums in einer lichtlosen, menschen- und lebensfeindlichen Welt, die Schwentkes Film als kennzeichnende Grundstimmung durchzieht. Denn als Kontrast zu dem Bösen in Gestalt einer dubiosen Organisation von Hautdieben, die ihren Opfern ihre organische Hülle zum Zwecke des Tattoo-Raubes zerschneiden und rauben, gibt es nirgendwo das wirklich Gute, das Helle, das rettende Ufer: Robert Schwentkes Hauptfiguren sind selbst nur Verlorene und a priori Gescheiterte, Prototypen des Prinzips des Antihelden.
Ihm zu Seite stellte Schwentke August Diehl als Jungpolizist Schrader. Auch er entspricht in keiner Weise seinem amerikanischen Alter Ego Brad Pitt in "Se7en", der zwar auch ein jugendlich-stürmischer Hitzkopf, aber zugleich auch liebevoller Ehemann und Hundehalter war und eine heile Welt besaß, in die er sich so lange zurückziehen konnte, bis er im grandiosen Finale des Fincher-Films eine Paketsendung erhielt. Polizeischulabsolvent Schrader hingegen ist ein spontaner, unreifer, planlos-agierender und stimmungsausgelieferter Charakter, einer, der sich trotz unzweifelhaft vorhandener Intelligenz bislang nur durchs Leben schummelt und lavierte, der alle seine Prüfungen nur mit Ach und Krach schaffte und in seiner Freizeit auch schon einmal kleine, bunte Pillen in Techno-Clubs verscherbelt.
Robert Schwentke führt seine beiden Hauptdarsteller mit einer beeindruckenden Disziplin. Christian Redl gibt den langsam, aber stetig in den Abgrund gleitenden Charakter des bulligen Minks mit ebenso faszinierender Minimalmimik wie auch physischer Präsenz. August Diehl, bekannt aus "23" und "Kalt ist der Abendhauch", zeigt hingegen mit jeder Szene, mit jedem bleichen, fiebrigen Mienenspiel, was für ein großartiger Theatermime er ist. Ihrem zurückhaltenden und zugleich ungemein intensiven Spiel ist es zu verdanken, dass die abgründig morbide Grundstimmung des Films zu keiner Sekunde ironisch gebrochen wird. Wie David Fincher in "Se7en" brandmarkt Schwenkte die soziale Erosion der namenlosen Großstadt, in der Minks und Schrader auf Mörderjagd gehen, als nachtschwarze Hölle auf Erden: Da verkauft ein Junkie im Endstadium seiner Heroinsucht Stücke der eigenen Haut für einen Schuss, wohlsituierte Anwälte ergötzen sich in verborgenen Hinterzimmern an Vernissagen makaberer menschlicher Hautartefakte, und ein Verdächtiger, der von Schrader gestellt wird, entzieht sich auf beispiellos makabere und blutige Weise der Verhaftung.
Vor allem Optik und Kameraführung machen die markanten Unterschiede zum deutschen Thriller-Pendant "Anatomie" aus. Auch dort ging es um geheime Praktiken und finstere Verschwörungen, garniert mit einigen explizit drastischen Schockszenen. Doch Stefan Ruzowitzkys Heidelberg-Slasher war trotz der Horroranleihen buntes Popcorn-Kino, dessen sanfter Grusel häufig genug ironisch verbrämt und gebrochen wurde. "Tattoo" tendiert hingegen zur Hardcore-Version von "Anatomie", ein monochromer, auswegloser und kompromissloser Alptraum ohne blondes Gretchen und ohne Licht am Ende des Tunnels, eine düstere, verstörende Nacht ohne Morgen. Mit diesem Debüt dürfte Robert Schwentke die Latte für seinen nächsten Film ungewöhnlich hoch gelegt haben. |
Besucher Nr. seit 01.04.2002
Diese Kritik ist die Meinung von Johannes Pietsch.

 Impressum.
Impressum.