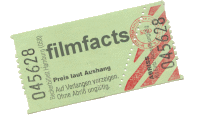
|
Herausgegriffen hat sich M. Night Shyamalan das Rätsel der sogenannten Kornkreise, jener großflächig niedergedrückten, hochsymmetrisch angeordneten geometrischen Strukturen in Getreidefeldern, die gegen Ende der 70er Jahre die Phantasie so mancher tatsächlicher und selbsternannter Wissenschaftler, Ufologen bis hin zu Glaubenstheoretikern beschäftigten und deren skurriler Kultcharakter, der bisweilen an den pseudowissenschaftlichen Tanz um ein goldenes Kalb erinnert, auch dann nicht gänzlich zum Erliegen kam, als sich 1991 die meisten dieser Agrarkunstwerke als Freizeitspaß eines britischen Rentnerduos entpuppten. Dabei sind die titelgebenden Kornkreise nur reiner Aufhänger für eine wieder traumwandlerisch zwischen den Genres und zwischen den Polen Horror und Drama mäandernde Story. Den Part von Bruce Willis als einsamer, zweifelnder und von den Schatten der Vergangenheit gepeinigter Held übernahm diesmal Mel Gibson. Als ehemaliger Priester Graham Hess hat er sich nach dem tragischen Unfalltod seiner Frau vom Glauben abgewandt und erzieht gemeinsam mit seinem Bruder Merril (Joaquin Phoenix) die beiden Kinder Morgan (Rory Culkin) und Bo (Abigail Breslin) auf einer einsam gelegenen Farm in Pennsylvania. Die auf einmal in seinen Maisfeldern erscheinenden akurat niedergewalzten geometrischen Formen sind nur ein Zeichen des nahenden Unheils: Tiere werden grundlos aggressiv, Grahams Kinder benehmen sich eigenartig und nachts sind rätselhafte Geräusche rund um die Farm zu hören. Die örtliche Polizei ist ratlos, sind doch die Erscheinungen auf Grahams Farm nicht die einzigen Ereignisse, die für Unruhe in der Bevölkerung sorgen. Und das nicht nur in Pennsylvania.
Wieder erzählt M. Night Shyamalan eine von Geisterhauch-Kälte umwehte Schattenreich-Parabel zwischen Mythos und Mysterium. Es gibt erneut die spielerische Verwirrung der Realitäts- und Genreebenen zu bestaunen, wiederum hat ein (diesmal besonders tragisches) Ehedrama einen wichtigen Bezug zum Geschehen, und wieder sind es kleine Kinder, die den Schrecken eher realisieren als ihre erwachsene Umwelt.
Trotz all dieser Anleihen und Verknüpfungen zum Mainstream-Kino ist "Signs" ein unverkennbarer Shyamalan geworden. Es ist vor allem die traumhafte, düstere Bildsprache des Regisseurs, die den Zuschauer fort von gewohnten Mainstream-Sehgewohnheiten in die Abgründe des Shyamalanschen Universums ziehen.
Hier zeigt sich der Regisseur als wahrer Hitchcockschüler, denn so wie es der Suspense-Meister einst beispielhaft vormachte, erzeugt Shyamalan den wahren Horror durch das, was er nur andeutet oder dem Zuschauer ganz vorenthält, durch Geräusche, Schattenrisse, schemenhaft angedeutete Gestalten und Formen, die nicht sein dürfen und nicht rational erklärbar sind, durch nicht erklärbare Geräusche aus Funkgeräten oder durch Fernsehsender, die plötzlich einfach verstummen. Fast ebenso so stark wie in "Unbreakable" kommt in "Signs" dieser somnambule Kamerastil zur Geltung, der die Bilder der weltentfremdeten Stimmung seiner Protagonisten anpasst. Alltägliche Gegenstände wie halbvolle Wassergläser gleiten bruchlos in eine spirituelle Rätselhaftigkeit, der sich auch völlig diesseitige Zuschauerkreise nicht entziehen können. Und wie schon in "6th Sense" und "Unbreakable" zeigt Shyamalan die entscheidenden Dinge am liebsten im Spiegel, als undeutliche Schemen auf der reflektierenden Oberfläche eines Fernsehbildschirms beispielsweise. Shyamalans Bilder wirken so entrückt wie die Figuren, die er in diesem Szenario kammerspielartig positioniert: Während das Ende der Welt über Pennsylvania und die übrige Welt hereinzubrechen droht, unterhalten sich Graham Ness und seine Familie über die Spaghetti und den Cheeseburger mit Extra Bacon, den es zum Abendessen geben soll.
Trotz dieser unübersehbaren Schwäche ist "Signs" eine düstere Meditation über das Unbekannte und Unheimliche, von dem wir erahnen, dass es "irgendwo da draußen" - vielleicht in einem Maisfeld oder auch auf dem Dach unseres Hauses - auf uns lauert, ein betörendes, verstörendes, atmosphärisches Stück Kino, das mit angenehm vielen Zeitgeist-Regeln des gängigen Hollywood-Mainstreams bricht. |
Besucher Nr. seit 01.09.2002
Diese Kritik ist die Meinung von Johannes Pietsch.

 Impressum.
Impressum.