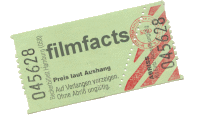
|
Für die Literatur war die Artussage stets ein nie versiegender Quell der Ideen, angefangen von Wolfram von Eschenbachs "Parzival" bis zum klebrig-schwülstigen Frauenversteher-Roman "Die Nebel von Avalon" der amerikanischen Fantasy-Autorin Marion Zimmer Bradley. Auch Hollywood zehrte lange an dem Nektar, den die Kraft der Sagengestalt bot, was von klassischen Kostümspektakeln à la Richard Thorpes "Die Ritter der Tafelrunde" über die Monty-Python-Persiflage "Die Ritter der Kokosnuß" bis zum Disney-Zeichentrick "Die Hexe und der Zauberer" reichte. Nachdem John Boorman 1981 mit "Excalibur" ein für alle mal gezeigt hatte, wie man König Artus zu verfilmen hat, versuchte sich anschließend nur noch Jerry Zucker in der reichlich peinlichen Ritter-Schmonzette "First Knight" von 1995 an dem Stoff.
Auf diesen historischen Kern der Artus-Sage berufen sich nun Jerry Bruckheimer und Antoine Fuqua: Runter vom efeu- und lorbeerumkränzten Sagen-Sockel und rein ins Kampfgetümmel, lautet das Credo des Blockbuster-Produzenten und des Action-Regisseurs, der nach "Training Day" einen Oscar für seinen Hauptdarsteller Denzel Washington verbuchen konnte. Befreit vom Legendenballast, von Minnegesang, Turniergeklapper und mythischem Brimborium um Merlin, Morgana, Mordred und das magische Schwert Excalibur sollte der entmystifizierte Keltenkönig in "King Arthur" als möglichst physische Kriegergestalt gegen die barbarischen Sachsen zu Felde reiten. Ein anspruchsvolles Unterfangen, welches sich nur dummerweise kaum mit dem quietschbunten Baukastensystem einer Bruckheimer'schen Popcorn-Blockbusters verträgt. Daß dieses - in Verbindung mit einem guten Regisseur, einiger talentierter Darsteller und ein paar unterhaltsamer Drehbucheinfälle - durchaus zu funktionieren vermag, bewies im vergangenen Jahr das prächtige Piratenspektakel "Fluch der Karibik", aber auch furchtbar nach hinten losgehen kann, wie man im Falle der Michael-Bay'schen Kollossal-Blamage "Bad Boys 2" erleiden mußte. "King Arthur" versucht den Spagat, ein naturalistisches Historienspektakel im Stil von Mel Gibsons "Braveheart" mit dem familien- und massenkompatiblen Mainstream-Entertainment von "Fluch der Karibik" in Einklang zu bringen und scheitert auf hohem Niveau - dies vor allem aber auf Grund der Schnitte, die die geldgebenden Studiobosse des Hauses Disney aus Freigabegründen bei Fuqua durchsetzten und die den Kampfszenen einen Großteil ihrer für die Authentizität zwingend notwendigen Blutrünstigkeit beraubten.
Drehbuchautor David Franzoni macht aus dem mythischen König von Camelot den römischen Kommandanten eines Elitetrupps gepanzerter sarmatischer Reiter. Ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht: Tatsächlich war seit Beginn des vierten Jahrhunderts schwere sarmatische Kavallerie in Britannien zum Schutz gegen die Einfälle von Pikten und Sachsen stationiert. Rund 5500 dieser kampfstarken vorderasiatischen Reiterkrieger hatte das schwankende römische Weltreich als Söldner auf die unruhige Insel geschickt. Ob es hingegen einen Anführer namens Lucius Artorius Castus gab und ob der dann auch noch den Ursprung für die Legenden um den sagenhaften König Artus bildete, sei einmal der Spekulation überlassen, doch tatsächlich geistert die Sarmaten-Connection als neue Deutung der Artus-Legende seit geraumer Zeit durch die Historiker-Kreise, und zugegeben: Sie ist wirklich sexy!
Doch was juckt's - schließlich sucht man in einem Bruckheimer-Films weniger nach einem historischen Seminar denn mehr nach Schauwerten - und die bietet das neueste Werk aus den Laboratorien des Doktor Bruckenstein fürwahr. Hauptdarsteller Clive Owen macht seine Sache als zaudernder, von Selbstzweifeln geplagter und 1340 Jahre vor der französischen Revolution über Liberté, Egalité und Fraternité philosophierender Edelrömer mehr als nur ordentlich, Ioan Gruffudd legt seinen doppelschwertschwingenden Elite-Killer Lancelot als Teenie-Schwarm par excellance an, und damit auch Männerherzen höher schlagen, gibt es das "Bend it like Beckham"-Beauty Keira Kneightley als blau angemalte und extrem knapp geschürzte Urwald-Amazone, die mit ihren Pikten einen Guerilla-Krieg gegen Sachsen und römische Besatzer führt. Zauberer Merlin (Stephen Dillane), bei Boorman noch die zentrale mystische Figur, bleibt als brummig brummelnder Antik-Che-Guevara ebenso farb- und gesichtslos wie die übrigen Römer, Briten und Pikten. Die Ritter der Tafelrunde heißen zwar immer noch Tristan, Galahad und Gawain, haben aber von ritterlicher Minne keine Ahnung und von der Gralssuche erst recht nicht, benehmen sich dafür allerdings bereits recht britisch, insbesondere der Gruppen-Proll Bors (Ray Winstone), den man sich statt mit einer Streitaxt auch mit einem Eimer Sangria auf Mallorca vorstellen könnte.
Nicht nur mit den martialisch bemalten Pikten und ihrem Vietcong-Kampfstil nimmt "King Arthur" deutliche Anleihen beim Western und beim klassischen japanischen Samurai-Film: Artus und seine Getreuen sind nichts anderes als ein antikes Abbild der "Glorreichen Sieben", der der geknechteten britischen Zivilbevölkerung gegen die finsteren sächsischen Invasoren zu Hilfe eilen, und der Einsatz von und Pfeilen und Langbögen (die die Briten bekanntermaßen ja erst 900 Jahre später im Hundertjährigen Krieg gegen die Franzosen als Kriegswaffe einsetzten, aber wen interessiert das schon) bei der von Slawomir Idziak grandios bebilderten Schlacht auf dem Eis eines zugefrorenen Sees läßt sicherlich nicht ganz zufällig Erinnerungen an den Pfeilregen aus Yang Zhimous "Hero" und ähnlichen Vorbildern des Schwertkämpferfilms aufkommen. Doch auch das Vergnügen der Schlachtszenen, deren finaler Höhepunkt sich deutlich an Gibsons "Brave Heart" und an Emmerichs "Patriot" orientiert, ist nicht ungetrübt, leiden sie doch in Folge der von Disney durchgesetzten Schnitte am Gladiator-Syndrom und wirken trotz fulminanten Gemetzels und hohen Bodycounts allzu anämisch.
So bleibt denn von einem prächtig inszenierten und ausstaffierten, allerdings auch völlig unhistorischen Historienspektakel nicht viel wirklich Tiefschürfendes in Erinnerung haften. Doch der Film-Artus und seine Zelluloid-Ritter können sich trösten, schließlich erging es ihren realen historischen Vorbildern kaum anders: Bekanntermaßen war den Siegen des echten Artus keine Dauer beschieden, und spätestens nach der Schlacht bei Bedcanford 571 nach Christus konnten die Sachsen ihre Eroberung der britischen Insel fortsetzen. Dem wirklichen Artus hätte es sicherlich Genugtuung verschafft, erleben zu können, daß rund 500 Jahre später den Sachsen durch die Normannen und einen gewissen William das gleiche Schicksal blühen sollte wie zu seiner Zeit den keltischen Briten - vielleicht dreht Jerry Bruckheimer ja als nächstes einen Film über die Schlacht von Hastings. |
Besucher Nr. seit 24.08.2004
Diese Kritik ist die Meinung von Johannes Pietsch.

 Impressum.
Impressum.