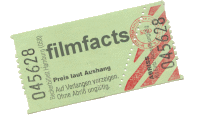
|
Doch die "Scream"-Welle verebbte auf Grund ihres doch recht begrenzten erzählerischen Bewegungsspielraums schnell, und in den Folgejahren mäanderte das Horror-Genre ziel- und orientierungslos zwischen groß budgetiertem Special-Effects-Spektakeln ("The mummy"), reichlich witzlosen Neuauflagen altbekannter Stoffe ("Wes Cravens Dracula") und vielen wirklich abgrundtief schlechten Filmen ("The In-Crowd", "Deep in the woods", "Valentine", "D-Tox", Ghost Ship" oder als wirklich grotesker Negativ-Höhepunkt der deutsche Genre-Beitrag "Swimming Pool", keinesfalls zu verwechseln mit dem gleichnamigen Ozon-Film) herum.
Mit "Dawn of the dead" steht nun das Remake des wohl am meisten wegweisenden und stilbildenden Horrorfilms der späten 70er Jahre ins Haus. "Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück" - kaum ein Film dürfte so massiv und nachhaltig das gesamte Genre auf den Kopf gestellt und bis heute geprägt haben wie George A. Romeros abgründige Weltuntergangs-Parabel über die menschenfressenden Untoten, die in einem postapokalytischen Amerika eine kleine Handvoll Überlebender in einem Einkaufszentrum belagern. Denn auch wenn das Kino der späten 70er Jahre lebende Tote schon lange kannte, Romero selbst den Grundstein des modernen Zombiefilms zehn Jahre zuvor mit seinem Meisterwerk "Night of the living dead" gelegt und Amando Ossori bereits vier Mal seine reitenden Leichen auf die Menschheit losgelassen hatte, erst mit "Dawn of the dead" avancierten die unbeholfen umherstaksenden, aber oft und gerne herzhaft zubeißenden Untoten zu den neuen Archetypen des Genres und der Begriff "Zombie" zum Synonym für Horrorfilme, die statt Grusel, Spannung oder Angst zu erzeugen nur noch möglichst magenumstülpende Blut- und Eingeweide-spritzende Schreckensspektakel veranstalteten. Der Erfolg von "Dawn of the dead", der weltweit fast 60 Millionen Dollar einspielte, löste zwischen nach 1979 eine schier unglaubliche Welle von Ekelfilmen aus, bei der sich vor allem italienische Regisseur wie Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, Joe d'Amato alias Aristide Massaccesi, Bruno Mattei und Marino Girolami mit Zombie- und Kannibalen-Machwerken der wirklich alleruntersten Schublade hervortaten, damit die Negativ-Belegung des Begriffes Zombie für die Ewigkeit festzementierten und auch Romeros Werk in erheblichem Maße diskreditierten. Bis heute scheuen Horrorfilm-Produzenten den Begriff Zombie wie der Gehörnte des sprichwörtliche Weihwasser, und so kommt auch das Remake von George A. Romeros Klassiker unter dem englischen Originaltitel in die Kinos und nicht dem deutschen, der vor 25 Jahren vor allem im prüden (West-)Deutschland für einen kollektiv-entsetzen Aufschrei sorgte: "Zombie"
Schon zu Beginn setzt Snyder deutlich andere Akzente: Stieß George A Romero den Zuschauer bereits mit der ersten Minute in das brodelnde Chaos des Weltuntergangs - wenn auch nur indirekt, nämlich im Tohuwabohu einer Fernsehstation kurz vor der Einstellung des Programms - so gönnt Werbefilmer Snyder dem Publikum noch einen kurzen Hauch heiler Welt und gepflegter Vorstadt-Idylle voller gepflegter Rasen, weiß gestrichener Vorgartenzäune und symmetrisch angelegter Garageneinfahrten, in die Krankenschwester Ana (Sara Polley) nach einem anstrengenden Arbeitstag zurückkehrt. Ein letztes Mal darf die Hauptfigur des Remakes noch eine geruhsame Nacht mit Ehemann und Tochter verbringen, bevor Snyder die Apokalypse mit einem wirklich perfiden Regieeinfall über seine ahnungslosen Opfer hereinbrechen lässt - der 11. September und die verlorene Unschuld Amerikas durch den völkerrechtswidrigen Irakkrieg werfen hier lange Schatten.
Überhaupt scheinen diese Zombies deutlich stärker von den sich in irrer Wut auf alles Lebende stürzenden Infizierten aus Danny Boyles "28 days later" inspiriert zu sein als von George A. Romeros schwerfällig und unbeholfen, mit stupid-verständnislosem Gesichtsausdruck dahintaumelnden sowie überwiegend lächerlich grün geschminkten Untoten. Zwar entspringt die Tricktechnik angenehmerweise nach wie vor klassischer Handarbeit, doch sind die Effekte state of the art und entsprechen und dem hohen Budget, so dass Zack Snyder seine Zombie-Kreationen in jedem beliebigen Grad der anatomischen Verunstaltung aufmarschieren lassen kann. Auch bei der Gewaltdarstellung ist der neue "Dawn of the dead" eindeutig ein Kind seiner Zeit: Zwar spart Zack Snyder nicht mit zerschossenen Köpfen, aufgebissenen Halsschlagadern und abgerissenen Gliedmaßen, zeigt diese aber genau wie Danny Boyle nur in den von hektischer Bildführung und hypernervöser Kamera dominierten Action-Sequenzen. Völlig verzichten muss der Hardcore-Splatterfan auf das genüssliche Ausweiden menschlicher Opfer und das Verspeisen kompletter Organ-Sortimente, was George A. Romero 1978 speziell während des Schluss-Kampfes von "Dawn of the dead" oftmals minutenlang in enervierender, nervenzermürbender Langsamkeit und in gnadenloser Großaufnahme zeigte.
Vor George A. Romeros Original verbeugt sich das Remake vor allem mit den Cameos gleich dreier Darsteller von einst: Tom Savini, Make-up-Spezialist und Darsteller eines Motorrad-Rockers, darf anno 2004 als erbarmungsloser Gesetzeshüter im TV erklären, dass die Untoten nur durch einen Kopfschuss zu erledigen seien. Scott H. Reiniger kommt kurz als Armee-General ins Bild, während der 78er Hauptdarsteller Ken Foree als Fernseh-Prediger nichts Geringeres als die berühmte Tagline zum Besten geben darf: "When there's no more room in hell, the dead will walk the earth." Auch die wohl bedrückendste Szene des Originals, in der Ken Foree die Waffe schussbereit in der Hand vor seinem gestorbenen Freund Scott H. Reiniger sitzt und darauf wartet, dass dieser als Zombie erwacht, um ihm darauf in Großaufnahme den Schädel zu schießen, findet sich im Remake wieder, allerdings in abgeschwächter Form mit einer Nebenfigur und einem Schuss, den der Zuschauer nur aus dem Off hört.
Der politische Subtext des independent entstandenen Romero-Films geht Zack Snyder indes völlig ab. Sein Remake ist auch kein Horror im eigentlichen Sinne, sondern ein harter, zynischer Action-Film, der angenehmerweise zu keiner Sekunde vorgibt, mehr sein zu wollen. Für Romero war "Dawn of the dead" eine Parabel auf den Kapitalismus. "Das hässliche", schrieb schon Friedrich Nietzsche, "ist die Betrachtungsform der Dinge unter dem Willen, einen Sinn, einen neuen Sinn in das sinnlos Gewordene zu legen" Filmemacher wie Romero oder Sam Raimi, Stuart Gordon, Dario Argento und Roy Frumkes lehnten sich Ende der 70er und Anfang der 80er mit ihren filmischen Blut-Exzessen auf gegen eine heile Konsenskultur, die im Laufe des Zivilisationsprozesses den menschlichen Körper disziplinierte und die Selbstkontrolle zum Signum der Moderne machte. Solcherlei Provokation könnte Zack Snyder jedoch auch gar nicht mehr begehen, da die Tabubrüche von vor 25 Jahren längst zu gängigen Kino-Stilmitteln avancierten, die keinerlei moralischen Entrüstungssturm mehr entfachen können.
7 von 10 Punkten |
Besucher Nr. seit 17.04.2004
Diese Kritik ist die Meinung von Johannes Pietsch.

 Impressum.
Impressum.